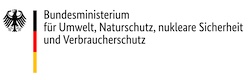Das Bio-Siegel und nachhaltiger Konsum (Kurzfassung)
Der deutsche Markt für Bio-Produkte wächst: Die Umsätze der Bio-Betriebe und der Anteil an Produkten aus ökologischer Produktion am Lebensmittelmarkt steigen.
Dabei werden manche Aspekte in Medien und Gesellschaft kontrovers diskutiert, etwa die Annahme, dass biologisch erzeugte Lebensmittel teurer seien. Auch Gesundheit ist immer wieder Thema: Sind Biolebensmittel gesünder? Ähnliche Fragen gibt es zu Klima, Umwelt und Tierwohl.
Trotz Ausnahmen: Für die Umwelt haben Bio-Lebensmittel insgesamt klare Vorteile. Die deutsche Politik fördert daher ihre Produktion.
Warum ist ein Wandel bei der Lebensmittelproduktion nötig?
Wie wir essen, beeinflusst nicht nur unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Es wirkt sich auch auf Umwelt, Klima und die Artenvielfalt aus. Das ist sehr vielen Menschen bewusst. Trotzdem sind die durchschnittlichen Ernährungsgewohnheiten nicht gesund und nachhaltig.
Um die schädlichen Auswirkungen zu reduzieren, braucht es ein nachhaltiges Ernährungssystem. Dieses kann durch ökologisch angebaute Lebensmittel erreicht werden. Deutschland fördert die ökologische Landwirtschaft daher mit politischen Maßnahmen und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 einen Flächenanteil von 30 Prozent zu erreichen.
Wie relevant ist die Lebensmittelproduktion für Umwelt und Klima?
Unser Lebensmittelkonsum wirkt sich erheblich auf das Klima aus. Laut Weltklimarat ist er für 21 bis 37 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich, in Deutschland etwa für 20 Prozent.
Das Ernährungssystem trägt auch zum Verlust von Arten beziehungsweise der biologischen Vielfalt bei, und es ist weltweit verantwortlich für 80 Prozent der Landnutzungsänderung.
Einen besonders großen ökologischen Fußabdruck, das heißt Ressourcenverbrauch, hat die Produktion von Lebensmitteln tierischen Ursprungs. Ihre Erzeugung geht mit einem hohen Einsatz endlicher Ressourcen wie Wasser, fruchtbarer Böden, Phosphor und fossiler Energien einher.
Wie kommt es zu Umweltbelastungen durch die Lebensmittelproduktion?
Die Landwirtschaft hat ihre Produktivität enorm gesteigert. Grund dafür sind technische Fortschritte, der Einsatz von leistungsstarken Maschinen, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie Fortschritte in der Züchtung. Diese Intensivierung hinterlässt Spuren.
Für die Erzeugung von Lebensmitteln wird außerdem Wasser benötigt, was in Gebieten mit Wasserknappheit ein Problem werden kann. Wasser wird auch bei der Verarbeitung von Lebensmitteln benötigt. Darüber hinaus wird Energie für Prozesse wie Trocknen, Garen und Kühlen eingesetzt.
Ein bedeutender Faktor für die Auswirkungen auf die Umwelt kann auch der Transport von Lebensmitteln sein. Ein Beispiel: Der CO2-Fußabdruck von Ananas liegt bei 0,6 Kilogramm CO2 pro Kilogramm beim Transport per Schiff und bei 15,1 Kilogramm CO2 pro Kilogramm beim Transport per Flugzeug.
Auch unsere Ernährungsweise spielt eine Rolle. So tragen Ernährungsweisen mit hohen Anteilen an tierischen Produkten zum Verlust der biologischen Vielfalt bei. Hinzu kommt: Auf dem Weg vom Feld zum Teller wird ein Drittel aller Lebensmittel verschwendet.
Wie ökologischer Landbau die Umwelt schont
Der ökologische Landbau ist eine weitgehend ressourcenschonende und umweltverträgliche Wirtschaftsform. Die Vorteile liegen darin, dass Böden und Gewässer besser vor schädlichen Stoffeinträgen geschützt werden und eine artgerechtere Tierhaltung unterstützt wird.
Bio-Bäuer*innen setzen keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel und mineralischen Dünger ein. Das trägt zum Schutz der Gewässer und der Biodiversität bei. Auch artgerechte Tierhaltung folgt im Biolandbau strengeren Kriterien.
Siegel kennzeichnen Bio-Lebensmittel
Nur wenn die Vorschriften der Europäischen Union befolgt werden, darf sich Landbau ökologisch oder biologisch nennen. In Deutschland sind die Bezeichnungen "Öko" und "Bio" gesetzlich geschützt und an entsprechenden Siegeln erkennbar.
Das EU-Bio-Logo kennzeichnet Bio-Produkte in der gesamten Europäischen Union. Zusätzlich gibt es das deutsche Bio-Siegel, das die gleichen Anforderungen hat wie das EU-Siegel.


Abbildungen: EU-Bio-Logo und Deutsches Bio-Logo
Für verarbeitete Lebensmittel gilt: Nur Produkte, die keine künstlichen Farbstoffe, künstlichen oder naturidentischen Aromen, synthetischen Süßstoffe oder gentechnisch veränderten Organismen enthalten, bekommen das Siegel. Sie dürfen nicht mit ionisierenden Strahlen (Radioaktivität) behandelt worden sein. Verarbeitete Lebensmittel müssen zu mindestens 95 Prozent Zutaten aus Öko-Anbau enthalten. Um das zu garantieren, werden die Herstellerbetriebe mindestens einmal pro Jahr kontrolliert.
Neben dem deutschen und EU-Bio-Siegel gibt es weitere Siegel von Anbauverbänden. Alle ihre Produkte entsprechen mindestens den EU-Vorschriften für ökologischen Anbau.



Abbildungen: Logos der Anbauverbände Demeter, Bioland und Naturland
Welchen Beitrag leistet die Öko-Landwirtschaft zur nachhaltigen Ernährung?
Bio-Lebensmittel sind in der Gesamtbetrachtung besser für die Umwelt als vergleichbare konventionelle Produkte.
Über einige Umweltbelastungen durch die Lebensmittelproduktion gibt das Bio-Siegel jedoch keine Auskunft – zum Beispiel über mögliche Wasserknappheit im Anbauland, Flächenbedarf, Transportmittel oder Energiebedarf für die Kühlung.
Auch im ökologischen Landbau wirken sich bestimmte Lebensmittel stärker auf die Umwelt aus als andere. Vor allem tierische Lebensmittel wie Rindfleisch und Milchprodukte sind mit hohen Treibhausgasemissionen verbunden.
Wie kann die nachhaltige Produktion von Lebensmitteln gefördert werden?
Bis 2050 soll es für alle Menschen in Deutschland möglich und einfach sein, sich gut zu ernähren, besagt die Ernährungsstrategie der Bundesregierung. Um dies zu erreichen, soll die Ernährung pflanzenbetont sein, mit möglichst ökologisch erzeugten, saisonal-regionalen Lebensmitteln und so wenig Lebensmittelabfällen wie möglich.
Eine zentrale Rolle spielt das Angebot von Lebensmitteln. Zum Beispiel soll es die Kennzeichnung von Lebensmitteln künftig leichter machen, gesunde und nachhaltige Lebensmittel zu wählen.
Was kann ich selbst tun?
Durch den persönlichen Ernährungsstil können wir großen Einfluss auf unseren Umweltfußabdruck nehmen. Doch im Detail kann Ernährung schnell sehr kompliziert werden, denn es gibt bei der Umweltbewertung viele Aspekte zu beachten. Häufig ist es nicht leicht, die entsprechenden Informationen für einzelne Produkte zu bekommen.
Das Umweltbundesamt empfiehlt, sich an einer Kurzformel zu orientieren: "Weniger tierische Produkte, mehr Bio". Darüber hinaus rät das Umweltbundesamt, Lebensmittelabfälle zu vermeiden und möglichst saisonal und regional einzukaufen.
Weiterführende Links
UBA: Biolebensmittel tragen zum Umwelt- und Tierschutz bei
BMEL: Bio-Siegel
UBA: Ökolandbau
Material herunterladen
- „Rundum“ gut für die Umwelt – worauf können wir bei Lebensmitteln achten? (Variante für Fortgeschrittene) - GS (PDF - 0 B)
- „Rundum“ gut für die Umwelt – worauf können wir bei Lebensmitteln achten? (Basisvariante) - GS (PDF - 0 B)
- Wie erkenne ich nachhaltige Lebensmittel? (Variante für Fortgeschrittene) - SK (PDF - 0 B)
- Wie erkenne ich nachhaltige Lebensmittel? (Basisvariante) - SK (PDF - 0 B)