Technischer Fortschritt
KI und Umweltschutz: Ein Überblick für die Bildungsarbeit
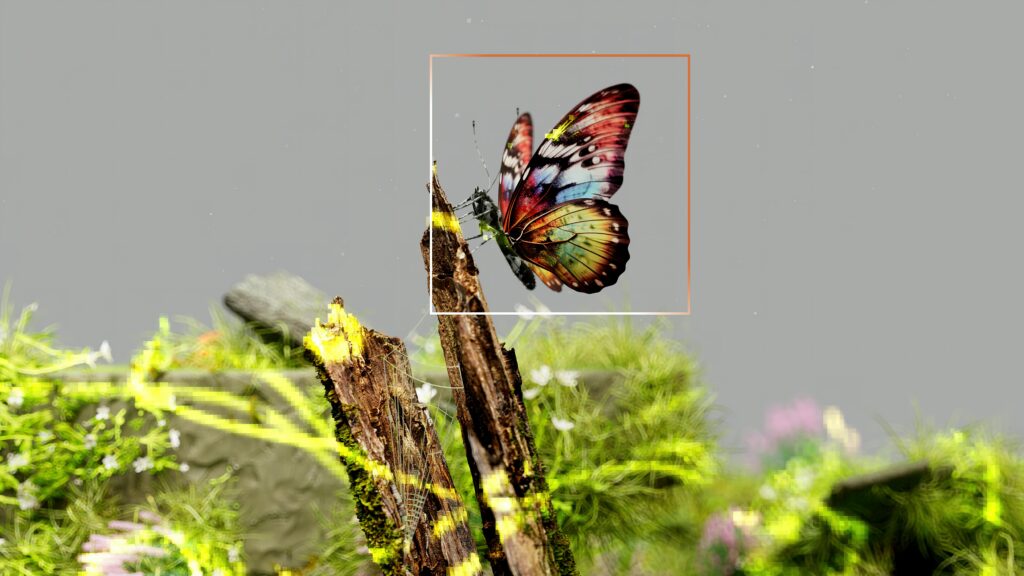
Foto von Google DeepMind, pexels
Einleitung
Künstliche Intelligenz (KI) verändert unseren Alltag rasant: Texte, Bilder oder Videos entstehen heute mithilfe von KI-Anwendungen in Sekunden. Auch in Medizin, Industrie oder Landwirtschaft spielt KI eine immer größere Rolle. Gleichzeitig werden Umweltfolgen wie Energie- und Wasserverbrauch diskutiert.
Dieser Text gibt einen Überblick über die Grundlagen, Chancen und Herausforderungen des Themas und dient als ergänzende Grundlage für die Lernpfade auf „Umwelt im Unterricht“, um das Thema zu vertiefen.
- Primarstufe: KI und unser Klima
- Sekundarstufe: Nachhaltige KI – geht das?
Begriffe kurz erklärt
Eine einheitliche Definition von KI gibt es nicht. Vereinfacht gesagt geht es darum, dass Computer Aufgaben selbstständig bearbeiten – also Muster erkennen, Vorhersagen treffen oder Entscheidungen unterstützen. Ein wichtiges Merkmal ist, dass KI-Systeme lernen können.
Im Zusammenhang mit KI begegnen uns häufig drei Begriffe, die eng zusammenhängen:
- Maschinelles Lernen: Computerprogramme lernen aus Daten, statt feste Regeln zu befolgen.
- Deep Learning / Neuronale Netze: Ein spezielles Verfahren des Maschinellen Lernens mit künstlichen neuronalen Netzen, das besonders gut Muster in großen Datenmengen erkennt. Neuronale Netze sind ein Netzwerk aus Datenknoten (ähnlich wie „Neuronen“ im Kopf), die miteinander verknüpft sind und dabei lernen, klare Aufgaben zu lösen.
- Generative KI: Baut auf Deep Learning auf und erstellt neue Inhalte wie Texte, Bilder oder Musik. Chatbots oder Bildgeneratoren beruhen darauf.
Anwendungsfelder
KI-Anwendungen können dabei helfen, Ressourcen zu sparen, Abläufe effizienter zu gestalten und Emissionen zu senken. Besonders in der Wissenschaft eröffnen sich dadurch ganz neue Möglichkeiten: Große Datenmengen lassen sich in kurzer Zeit analysieren, Muster werden sichtbar und Prognosen können verbessert werden.
Eine wichtige Rolle beim Sammeln solcher Daten spielt Citizen Science. Ein spannender Ansatz, bei dem Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammenkommen, ist Citizen Science. Hier beteiligen sich Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Forschung, etwa durch Beobachtungen, Fotos oder Messungen. Diese Beteiligung schafft eine wertvolle Datengrundlage und bringt zusätzliches Wissen und Erfahrungen aus der Praxis ein. Mehr dazu auch im Hintergrundtext Citizen Science – Gemeinsam Wissen schaffen! https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrundtext/citizen-science-buergerwissenschaft-die-grundlagen-und-moeglichkeiten-fuer-die-bildungspraxis/
KI kann solche Citizen Science Projekte zusätzlich unterstützen – etwa durch Bilderkennungs-Apps wie Flora Incognita, die Pflanzenbestimmung erleichtern und so das Monitoring vereinfachen.
Beispiele für den Einsatz von KI-Anwendungen sind:
- KI-basiertes Monitoring: Erfassung vergangener und aktueller Vorgänge (z. B. Verkehrsnutzung, Kundenverhalten, Artenvielfalt).
- KI-basierte Vorhersagen: Prognosen künftiger Entwicklungen (z. B. Wetter, Marktnachfrage, Verkehr).
- KI-basierte Empfehlungen: Handlungsvorschläge auf Basis von Monitoring- und Vorhersagedaten (z. B. Maschinennutzung, Kundenangebote, Infrastruktur).
- KI-assistierte Steuerung: Unterstützung bei Entscheidungen und Prozessen (z. B. Logistik, Anlagenwartung, Produktion, intelligente Verkehrs- und Stromnetze).
(Vgl. Plattform Lernende Systeme (2022): Mit KI den nachhaltigen Wandel gestalten – Zur strategischen Verknüpfung von Künstlicher Intelligenz und Nachhaltigkeitszielen. https://doi.org/10.48669/pls_2022-5, Seite 18)
In den Lernpfaden zum Thema werden die Beispiele wie folgt eingebaut:
- In der Übung „KI in Aktion!” setzen sich junge Lernende der Klassen 4–6 mit Beispielprojekten auseinander, in denen Vogelstimmen erkannt, Pflanzen bestimmt, Wettervorhersagen verfeinert und die Mülltrennung sowie das Recycling unterstützt werden.
- Für Lernende ab Klasse 7 geht es in der Übung „Anwendungen für den Umweltschutz” darum, Einsatzgebiete wie Smart Farming, Meeresschutz und Energieversorgung unter die Lupe zu nehmen.
Spannende Beispiele sind auch die acht geförderten KI-Leuchtturmprojekte. Ob Riffe, Seegraswiesen, städtische Grünflächen oder Forstgebiete: Die Projekte setzen innovative Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) für den Schutz wichtiger Naturräume ein. Mehr dazu findest du hier: https://www.bundesumweltministerium.de/pressemitteilung/kuenstliche-intelligenz-im-einsatz-fuer-den-natuerlichen-klimaschutz.
Chancen und Herausforderungen – Green AI
Die ökologische Nachhaltigkeit im Kontext von KI wird häufig unter dem Begriff „Green AI“ zusammengefasst. Das Ziel besteht darin, den Energieverbrauch und den CO₂-Ausstoß beim Training und Betrieb von KI-Modellen sowie bei der Herstellung und Entsorgung der dafür notwendigen Hardware zu reduzieren.
Insbesondere große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) wie ChatGPT benötigen enorme Energiemengen und verursachen einen hohen CO₂-Ausstoß – nicht nur durch den Betrieb, sondern auch durch die Produktion und den Lebenszyklus der spezialisierten Hardware. Demgegenüber fallen beim Training spezialisierter Modelle, etwa für Bilderkennung, geringere CO₂-Mengen an. Auch bei der Nutzung zeigen sich Unterschiede: Für die Erkennung von Seegras auf Satellitenbildern reicht ein kleines Modell völlig aus, während ein großes Sprachmodell hier überdimensioniert und ineffizient wäre.
Einige Ansätze versuchen, unnötige Komplexität in KI-Modellen zu verringern. So aktivieren Sparse-Modelle nur die für eine spezifische Aufgabe oder Eingabe relevanten Teile eines neuronalen Netzes, statt das gesamte Modell zu nutzen. Ein Beispiel ist das Konzept Mixture of Experts: Das Modell erkennt, welche Eingabe zu welchem „Expert“ passt, und leitet sie gezielt weiter. Dadurch bleiben bei einer Anfrage nur kleine Teile aktiv – der Stromverbrauch sinkt deutlich, ohne dass die Qualität der Ergebnisse leidet. (Vgl. Interview mit Ana Klimovic, Auf dem Weg zu einer nachhaltigeren KI-Revolution: «Die Forschung für effiziente KI ist unerlässlich»)
Diese Unterschiede verdeutlichen: Die Wahl des richtigen Modells ist entscheidend für Effizienz und Nachhaltigkeit. Green AI bedeutet daher, im gesamten Technologielebenszyklus – von der Planung über die Chipproduktion, das Training,die langfristige Nutzung und die Entsorgung oder das Recycling der Hardware – bewusste Entscheidungen zu treffen. So lassen sich ökologische Belastungen reduzieren und gleichzeitig gesellschaftlicher Nutzen schaffen.Auch stellt sich die Frage, wie die für KI-Systeme benötigte Energie erzeugt wird und wie die physische Hardware nachhaltig hergestellt und am Ende ihres Lebenszyklus recycelt wird. Studien zeigen, dass der Energiebedarf durch KI in den kommenden Jahren stark steigen wird: Der KI-bedingte Verbrauch in Rechenzentren könnte bis 2028 auf rund 300 Terawattstunden anwachsen – das entspricht etwa einem Prozent des weltweiten Stromverbrauchs (Umweltbundesamt). Aus den USA wurde zudem berichtet, dass Google den Bau von Atomkraftwerken in Betracht zieht, um den wachsenden Energiebedarf für KI in Rechenzentren zu decken. Das Entwicklerteam des 2025 veröffentlichten Sprachmodells Aprtes aus der Schweiz betonte hingegen, für das Training klimaneutralen Strom genutzt zu haben. (ETH ZÜrich News)
Bedeutung für Schule und Bildung
KI ist längst Teil des Alltags von Lernenden – ob in Social Media, beim Schreiben oder für Hausaufgaben. Umso wichtiger ist es, dass junge Menschen verstehen, wie KI funktioniert, welche Chancen sie für Nachhaltigkeit bietet und wo Risiken liegen. Die Inhalte sollen verdeutlichen, dass technologische Fragen stets auch ökologische und gesellschaftliche Dimensionen haben.
An dieser Stelle empfehlen wir die Materialien der KI-Box Klima https://ki-box-klima.de/, die den Zusammenhang von KI und Klimaschutz praxisnah aufgreifen. Anschaulich und leicht verständlich werden in dem Begleitheft zur KI-Box Klima Funktionalitäten, Begriffe und Methoden beschrieben und vorgestellt.
Die Materialien und Inhalte stehen unter der CC BY-SA 4.0 Lizenz. Erstellt durch mycelia gGmbH für das BMUKN.