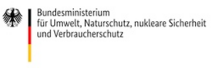Handeln für Umwelt- und Klimaschutz auf positive Weise fördern
Was ist der Anlass?
Was wissen Menschen über Umwelt- und Klimaschutz – und wie hängt dieses Wissen mit ihrem Verhalten zusammen? Über diese Frage wird viel diskutiert. Denn die Herausforderungen angesichts der globalen Klima- und Biodiversitätskrise sind groß, und unser bisheriges Handeln reicht nicht aus, um ihnen angemessen zu begegnen.
Darum bemühen sich viele Akteur*innen, mehr Menschen zu aktivem Handeln zu motivieren. Eine zentrale Rolle spielen dabei gezielte Kommunikationsmaßnahmen. Immer deutlicher zeigt sich jedoch, dass manche dieser Maßnahmen an Grenzen stoßen.
Insbesondere negative Botschaften können unerwünschte Folgen haben. Unter Umständen können sie Ohnmachtsgefühle und Abwehr auslösen oder verstärken. (Details siehe Abschnitt: Welche Botschaften lösen negative Reaktionen aus?)
Im vorliegenden Text geht es darum, wie solche Ohnmachtsgefühle und Abwehrhaltungen entstehen, wie sie vermieden werden und auf welche Weise Motivation und aktives Handeln für Veränderungen gefördert werden können.
Beispielhaft wird das Konzept des Handabdrucks vorgestellt. Es zielt darauf, einen neuen, positiven Blick auf eigene Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Oft geht es in der Umwelt- und Klimakommunikation darum, schädliche Wirkungen aufzuzeigen und zu vermeiden – wie zum Beispiel beim ökologischen Fußabdruck bzw. CO2-Fußabdruck.
Mit dem Handabdruck soll dagegen aufgezeigt werden, welche Handlungen viel für Umwelt- und Klimaschutz bewirken können. Zudem geht es nicht darum, einzelne Handlungen im Alltag zu bewerten, sondern darum, die Bedingungen für nachhaltiges Handeln für alle zu verbessern.
Zum Konzept des Handabdrucks liegen umfangreiche Materialien vor, die auch in der Bildungsarbeit eingesetzt werden können. (siehe Abschnitt "Handabdruck": Auf positive Weise Engagement fördern)
Warum sind Verständnis und Motivation so wichtig für Umwelt- und Klimaschutz?
Um eine intakte Umwelt und ein gesundes Klima sicherzustellen, müssen sich viele Dinge in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verändern hin zu mehr Nachhaltigkeit. Diese weitreichenden Veränderungen können nur gelingen, wenn sie von der gesamten Gesellschaft mitgetragen werden. Voraussetzung dafür sind Verständnis, Motivation zur Mitwirkung und entsprechendes Handeln.
Sind wir gut über Umwelt- und Klimathemen informiert?
Grundsätzlich sind Umwelt- und Klimathemen bereits stark im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert, wie es unter anderem die regelmäßig durchgeführte Studie Umweltbewusstsein in Deutschland zeigt. Dies gilt weiterhin, auch wenn in der jüngeren Vergangenheit andere politische Themen in den Vordergrund gerückt sind, wie z.B. der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.
So wünschen sich 91 Prozent der Befragten eine umwelt- und klimafreundliche Wirtschaft, 85 Prozent geben an, bereits starke Auswirkungen der Klimaveränderungen wie Trockenheit bzw. Dürren wahrzunehmen.
Wie berichten Medien über Umwelt- und Klimathemen?
Für das Umweltbewusstsein spielt die Medienberichterstattung eine zentrale Rolle. In den Medien sind Umwelt- und Klimathemen seit langem präsent. Insbesondere die Klimakrise spielt seit rund 20 Jahren eine große Rolle in der Berichterstattung. Analysen zeigen jedoch, dass die Berichterstattung dem komplexen Gegenstand nur selten gerecht wird.
Ein Grund ist die Logik bzw. Arbeitsweise im Journalismus. Hohen Nachrichtenwert haben vor allem aktuelle und spektakuläre Ereignisse, darunter oft Katastrophen. In den Medien nehmen darum insbesondere Alarmismus und Warnungen viel Raum ein. Über mögliche Lösungen berichten Medien dagegen weniger.
Kommunikation für Umwelt- und Klimaschutz
Verschiedenste Akteure bemühen sich, mit gezielten Kommunikationsmaßnahmen die öffentliche Präsenz von Umwelt- und Klimathemen sowie das Umweltbewusstsein weiter zu fördern, um Menschen zum Handeln für Klima- und Umweltschutz zu bewegen.
Dazu gehören NGOs, Wissenschaftler*innen, Regierungen sowie Regierungseinrichtungen wie zum Beispiel Umweltschutzbehörden und nicht zuletzt die Vereinten Nationen und ihre Einrichtungen.
Beispielhafte Kommunikationsmaßnahmen sind:
- Vermittlung von Informationen über Zusammenhänge ("Aufklärung", z.B. Sachinformationen wie auf der Internetseite des Umweltbundesamtes),
- Informationen über konkrete Handlungsoptionen (z.B. Ratgeber von Umweltschutzverbänden wie dem NABU),
- Appelle an gemeinsame Werte bzw. Ziele (z.B. Global Climate Action - Umweltprogramm der Vereinten Nationen)
Wissen ist nicht gleich Handeln
Wie wirkt sich die Präsenz von Umwelt- und Klimathemen auf das individuelle Verhalten aus? Und wie wirksam sind die Bemühungen, durch Kommunikationsmaßnahmen Menschen zu mehr Engagement zu motivieren?
Studien zeigen, dass der Weg vom Wissen zum Handeln komplex ist und von verschiedenen Faktoren abhängt. Klar ist: Wissen allein führt oft nicht dazu, dass Menschen ihr eigenes Verhalten entsprechend verändern.
Untersuchungen wie die regelmäßig durchgeführte Umweltbewusstseinsstudie belegen zwar eine sehr große Zustimmung und hohe Erwartungen bei zentralen Bereichen des Umwelt- und Klimaschutzes. Doch dies überträgt sich nicht im gleichen Maße auf das Handeln im Alltag.
So stimmen neun von zehn Befragten der Aussage zu, dass jede*r Einzelne Verantwortung übernehmen sollte, um nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Der Aussage "Ich engagiere mich aktiv für den Umwelt- und Naturschutz" stimmen dagegen 17 Prozent der Befragten zu.
Bei anderen Aussagen liegen die Werte teilweise höher, zum Beispiel: "Ich setze mich an meinem Arbeitsplatz für umweltfreundliche Veränderungen ein" (37 Prozent) oder "Ich boykottiere umwelt- und klimaschädliche Firmen" (34 Prozent). Doch die angegebene Bereitschaft bezüglich einzelner Verhaltensweisen ist jeweils höher als die Angaben zur Umsetzung im eigenen Alltag.
Für diese Unterschiede gibt es eine Reihe von Gründen.
Teilweise spielen praktische Faktoren eine Rolle. Menschen sind vor allem dann bereit, ihr Verhalten zu ändern, wenn sie dafür auf wenig verzichten müssen und die Veränderung möglichst wenig zusätzlichen zeitlichen, organisatorischen und finanziellen Aufwand für sie bedeutet. Klimafreundliche Mobilität zum Beispiel lässt sich in Städten mit kurzen Wegen und einem attraktiven öffentlichen Nahverkehr wesentlich leichter im Alltag umsetzen als auf dem Land.
Doch Kosten-Nutzen-Motive und Gewohnheiten sind nicht immer ausreichend, um die Kluft zwischen Bewusstsein und Verhalten zu erklären.
Die Motivation für Veränderungen hängt auch davon ab, ob wir uns selbst verantwortlich fühlen. Die wichtigste Rolle beim Umwelt- und Klimaschutz sieht die Mehrheit nicht primär bei den einzelnen Bürger*innen.
Laut Umweltbewusstseinsstudie finden viele Befragte, dass andere gesellschaftliche Akteure mehr tun sollen. Zwei Drittel geben an, dass die Bundesregierung nicht genug für Umwelt- und Klimaschutz tut. Besonders kritisch werden Industrie und Wirtschaft bewertet.
Darüber hinaus spielt die Psychologie eine Rolle. Für die Handlungsmotivation ist es demnach wichtig, ob Menschen das Gefühl haben, etwas ändern zu können. Die Psychologie hat dafür den Begriff Selbstwirksamkeitserwartung geprägt. Auch die Wahrnehmung sozialer Normen und der Wirkung des gemeinsamen Handelns spielen eine Rolle: Wie verhalten sich die anderen? Können wir als Gruppe oder Gesellschaft gemeinsam etwas erreichen?
Welche Botschaften lösen negative Reaktionen aus?
Psychologische Faktoren liefern auch die Erklärung dafür, dass das Wissen über bzw. die Wahrnehmung von Umwelt- und Klimaproblemen sogar Veränderungen im Wege stehen kann. Unter Umständen kann es vorkommen, dass Menschen resignieren und glauben, nichts bewirken zu können.
Angesichts der verfügbaren Informationen kann es auch schwerfallen, sich zu orientieren und die Alternativen abzuwägen. Zu viele Möglichkeitenkönnen auch belastend sein, unter anderem weil es kaum möglich ist, alle Empfehlungen umzusetzen. ("Aktivismus-Burn-Out")
Darüber hinaus lässt sich beobachten, dass das Thema Klimaschutz bei manchen Menschen auf Ablehnung oder Widerstand stößt.
Dass Risiko ablehnender Reaktionen besteht insbesondere bei negativen Aussagen. Dazu gehören zum Beispiel Warnungen vor den Folgen der Klima- und Biodiversitätskrise oder vorwurfsvolle Verweise auf die individuelle Mitverantwortung.
Auch die Veranschaulichung der klimaschädlichen Auswirkungen des individuellen Handelns mittels CO2-Fußabdruck vermittelt negative Botschaften und betont die individuelle Mitverantwortung.
Vor dem Hintergrund, dass viele Menschen die Verantwortung für mehr Engagement primär bei anderen Akteuren wie der Politik oder der Wirtschaft sehen, sind negative Reaktionen auf bestimmte Botschaften leicht nachvollziehbar.
Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?
Die Forschung zu Umwelt- und Klimakommunikation bestätigt, dass Informationen oder Kommunikationsmaßnahmen unterschiedlich wirken – je nach Situation und anhängig von der Überzeugung der Menschen, an die sie sich richten.
Gleichzeitig braucht der Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft die Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen. Dazu muss eine aktive Beteiligungskultur gefördert werden, die Menschen motiviert, sich ausgehend von ihren jeweiligen Lebenslagen und Interessen tatkräftig in die nachhaltige Gestaltung ihrer Umwelt einzubringen.
Damit entsprechende Kommunikationsmaßnahmen wirksam sein können und um das Risiko negativer Reaktionen zu verringern, müssen sie die individuellen Eigenschaften und Bedürfnisse der Adressat*innen berücksichtigen.
Ein Ansatz ist, bei der Kommunikation mit Bürger*innen eine mögliche Überforderung durch ein Zuviel von Appellen und Informationen zu vermeiden.
Der "Handabdruck": Auf positive Weise Engagement fördern
Der sogenannte Handabdruck ist ein Ansatz, der diesen Hintergrund berücksichtigt. Er zielt darauf, das Engagement für Umwelt- und Klimaschutz zu fördern und gleichzeitig negative Wirkungen anderer Ansätze der Umwelt- und Klimakommunikation wie Ohnmacht und Ablehnung zu vermeiden.
Ziel ist, die Strukturen und Rahmenbedingungen zu verändern – zum Beispiel in der Schule oder an der Uni, am Arbeitsplatz, im Verein, in der eigenen Stadt oder Gemeinde.
Im Sinne des Handabdrucks aktiv werden heißt zum Beispiel: Sich einsetzen für bessere Busverbindungen und einen sicheren Radweg zur Schule statt "nur" möglichst oft auf das Auto zu verzichten. Oder: Sich dafür einsetzen, dass die Schulmensa klimafreundliches Bio-Essen anbietet, das sich alle leisten können, statt "nur" mittags zu überlegen, welches Essen möglichst wenig klimaschädlich ist.
Der Ansatz richtet sich an Interessierte, die den Wandel zu einer nachhaltigeren Welt aktiv mitgestalten wollen. Entwickelt wurde das Konzept des Handabdrucks von der Organisation Germanwatch.
Der "Handabdruck" in der Praxis
Es liegt eine umfangreiche Sammlung an Tools, Guides und Publikationsmaterialien vor, die dazu dient, das Konzept anzuwenden, zum Beispiel in der Bildungspraxis oder im Rahmen des persönlichen Engagements.
Beim Einstieg helfen verschiedene interaktive Tools. Dazu gehören der "Handel-O-Mat" und der "Handabdruck-Test". Darüber hinaus gibt es zum Handabdruck "Do-It-Guides" mit praktischen Tipps.
Lehrkräfte können das Konzept des Handabdrucks im Unterricht einsetzen. Neben den Materialien von Umwelt im Unterricht gibt es umfangreiche Materialien von Germanwatch für die Bildungspraxis.
Weiterführende Links
Material herunterladen
- Kommunikation, die wirkt: Vom Wissen zum Handeln für Umwelt- und Klimaschutz (Variante für Fortgeschrittene) - SK (PDF - 103 KB)
- Kommunikation, die wirkt: Vom Wissen zum Handeln für Umwelt- und Klimaschutz (Basisvariante) - SK (PDF - 100 KB)
- Umweltschutz & du: Stell dir vor, es wäre noch viel einfacher ... (Variante für Fortgeschrittene) - GS (PDF - 80 KB)
- Umweltschutz & du: Stell dir vor, es wäre noch viel einfacher ... (Basisvariante) - GS (PDF - 81 KB)