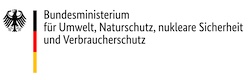Fast Fashion vs. Slow Fashion (Basisvariante)
Überblick über den Unterrichtsverlauf
- Einstieg: Die Schüler*innen reflektieren mithilfe einer Bilderserie ihren Konsum von Kleidung und besprechen den Begriff "Fast Fashion".
- Arbeitsphase: Die Schüler*innen tauschen sich über die Herkunft ihrer Kleidung aus, recherchieren zu den Auswirkungen der Herstellung und tragen die Ergebnisse in einer Weltkarte ein.
- Abschluss: Die Schüler*innen diskutieren die Ergebnisse im Plenum, entwickeln gemeinsam Lösungsansätze und notieren die wichtigsten Punkte auf ihren Karten.
Kompetenzen und Ziele
Die Schüler*innen …
- lernen grundlegende Auswirkungen der Herstellung von Textilien auf die Umwelt, das Klima und die Menschen kennen,
- erweitern ihre Methodenkompetenz durch die Analyse von Bildern mit thematischem Bezug sowie eine Recherche zur Herkunft und den Produktionsauswirkungen von Kleidungsstücken.
- schulen ihre Argumentations- und Kommunikationskompetenz durch die Arbeit in Gruppen und Diskussionen im Plenum,
- fördern ihre Handlungskompetenz, indem sie ihr eigenes Konsumverhalten reflektieren.
Umsetzung
Die Leitfragen der Unterrichtseinheit lauten:
- Wie beeinflusst der Kauf unserer Kleidung die Umwelt und die Menschen am Produktionsort?
- Wie lassen sich Produktionsbedingungen für Textilien weltweit verbessern?
Einstieg
Zum Einstieg präsentiert die Lehrkraft als Impuls die ersten drei Motive der Bilderserie "Machen Kleider Leute?". Die Bilder veranschaulichen das Phänomen "Fast Fashion", also die Vermarktung schnell wechselnder Kollektionen zu günstigen Preisen.
Die Schüler*innen besprechen die Bilder im Plenum anhand folgender Aufgabenstellungen:
- Erklärt, welche Bedeutung Kleidung für euch hat.
- Überlegt, wie oft ihr neue T-Shirts kauft und wie viel diese im Durchschnitt kosten.
- Schätzt, wie viele T-Shirts ihr besitzt (wahlweise kann auch ein anderes Kleidungsstück gewählt werden) und wie viele ihr davon kaum oder gar nicht tragt.
Anschließend stellt die Lehrkraft den Begriff "Fast Fashion" zu Diskussion. Er wird für alle sichtbar an der Tafel/dem Smartboard notiert. Die Schüler*innen werden aufgefordert, den Begriff zu interpretieren. Zur Unterstützung können Medienbeiträge präsentiert werden, zum Beispiel vom Umweltbundesamt, von Greenpeace oder in überspitzter Form von extra3. Die Aussagen der Schüler*innen werden in Form einer Clustermap festgehalten. Gegebenenfalls ergänzt die Lehrkraft folgende Informationen:
- schnell wechselnde Kollektionen/Trends,
- möglichst günstige Preise,
- häufig geringe Qualität und Haltbarkeit,
- häufiger Neukauf von Kleidung,
- Kleidung bleibt teilweise ungetragen,
- intakte Kleidung wird immer schneller ersetzt.
Arbeitsphase
Im Folgenden setzen sich die Schüler*innen mit den einzelnen Schritten der Produktion von "Fast-Fashion"-Produkten auseinander. Sie arbeiten heraus, welche Probleme damit einhergehen und entwickeln Lösungsansätze. Zur Unterstützung erhalten sie das Arbeitsblatt aus den Materialien.
Dafür überprüfen die Schüler*innen zunächst in Partnerarbeit, wo ihre eigene Kleidung produziert wurde, aus welchem Material sie besteht (zum Beispiel Baumwolle, Wolle, Leder, Polyester). Anschließend recherchieren sie im Internet, in welchen Ländern die verschiedenen Ausgangsmaterialien produziert werden.
Ihre Ergebnisse nutzen die Schüler*innen, um die globale Wertschöpfungskette eines Kleidungsstückes auf einer Weltkarte darzustellen. Entweder nutzen sie dafür die Karte aus den Materialien oder sie erstellen eine digitale Karte (beispielsweise mit Google Maps oder Open Maps). (Hilfestellungen finden sich bei Umwelt im Unterricht.)
Als Nächstes veranschaulicht die Lehrkraft mithilfe der übrigen Motive der Bilderserie, dass die einzelnen Produktionsschritte von Kleidung (insbesondere „Fast Fashion“) mit zahlreichen Auswirkungen auf die Umwelt, das Klima und die Menschen vor Ort verbunden sind.
Die Schüler*innen erhalten den Auftrag, in Gruppen Details zu den verschiedenen Auswirkungen zu recherchieren. Sie können dafür die auf dem Arbeitsblatt gelisteten Internetquellen heranziehen. Ihre Ergebnisse präsentieren sie im Plenum.
Abschluss
Die Schüler*innen diskutieren die Ergebnisse im Plenum und notieren die wichtigsten Auswirkungen auf ihren Weltkarten.
Anschließend fordert die Lehrkraft die Schüler*innen auf, gemeinsam Antworten auf folgende Fragen zu finden:
- Wie ist es möglich, dass Kleidungsstücke so günstig verkauft werden können?
- Welche ökologischen und sozialen Aspekte sind in diesem Preis nicht enthalten?
- Welche Lösungsansätze für eine nachhaltigere Textilproduktion gibt es? (Was macht ein gutes Arbeitsverhältnis zwischen Modeunternehmen und ihren Arbeitnehmer*innen beziehungsweise den Arbeitnehmer*innen ihrer Zulieferer aus? Wie können Umweltauswirkungen reduziert werden?)
- Was kann jede*r Einzelne tun, um nachhaltige Textilproduktion zu unterstützen?
Die Lehrkraft sichert die Ergebnisse der Diskussion an der Tafel/dem Smartboard. Zum Abschluss tragen die Schüler*innen die besten Lösungsansätze ebenfalls auf ihren Weltkarten ein. Wenn möglich, werden die Karten in der Schule/Klasse ausgestellt.
Erweiterung
- Die Schüler*innen organisieren eine Kleidertauschbörse in der Schule oder im Wohngebiet.
- Die Schüler*innen befragen ein (nachhaltiges) Textillabel, welche Ansätze dieses verfolgt, um die Bekleidungsindustrie ein Stück weit nachhaltiger zu gestalten.
- Die Schüler*innen entwickeln einen Einkaufsführer für nachhaltigen Kleidungskonsum.
- Die Schüler*innen recherchieren, wie und inwieweit Nachhaltigkeit bei großen Modelabels umgesetzt wird. Hierbei kann auch die Art, wie dies beworben wird, analysiert werden.
- Die Schüler*innen erstellen eine gemeinsame Präsentation und halten diese in anderen Klassen, um über die Folgen von "Fast Fashion" aufzuklären.
![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer
Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
Dieses Werk ist lizenziert unter einer
Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
Sie dürfen diesen Text unter anderem ohne besondere Genehmigung verwenden und bearbeiten, z.B. kürzen oder umformulieren, sowie weiterverbreiten und vervielfältigen. Dabei müssen www.umwelt-im-unterricht.de als Quelle genannt sowie die oben genannte Creative Commons-Lizenz verwendet werden. Details zu den Bedingungen finden Sie auf der Creative Commons-Website.
![]() Umwelt im Unterricht unterstützt die Erstellung von Bildungsmaterialien unter offenen Lizenzen im Sinne der
UNESCO.
Umwelt im Unterricht unterstützt die Erstellung von Bildungsmaterialien unter offenen Lizenzen im Sinne der
UNESCO.
Häufig wird Kleidung in Ländern hergestellt, in denen die Auswirkungen auf die Umwelt und die Arbeitsbedingungen der Menschen kaum beachtet oder kontrolliert werden. Wie kann Mode menschen- und umweltfreundlicher werden?
mehr lesenSeit einigen Jahren geht der Trend zu "Fast Fashion": Kleidung, die günstig gekauft, kaum getragen und schnell wieder abgelegt wird. Häufig wird sie in Ländern hergestellt, in denen die Auswirkungen auf die Umwelt und die Arbeitsbedingungen der Menschen kaum beachtet oder kontrolliert werden. Wie kann Mode menschen- und umweltfreundlicher werden?
mehr lesen
Foto: Karl Wiggers / Unsplash.com / Unsplash-Lizenz
Mithilfe der Materialien erarbeiten die Schüler*innen die globale Wertschöpfungskette von Kleidungsstücken.
mehr lesenMaterial herunterladen
- Immer schneller, immer mehr? Wege zur nachhaltigen Bekleidung (Kurzfassung) - GS / SK (PDF - 0 B)
- Immer schneller, immer mehr? Wege zur nachhaltigen Bekleidung - GS / SK (PDF - 0 B)
 Welche Bedeutung hat Kleidung? (PNG - 1 MB)
Welche Bedeutung hat Kleidung? (PNG - 1 MB)Foto: IQRemix / Flickr.com / CC BY-SA 2.0
 Wie oft kaufst du Kleidung und wie viel Geld gibst du dafür aus? (JPG - 333 KB)
Wie oft kaufst du Kleidung und wie viel Geld gibst du dafür aus? (JPG - 333 KB)Foto: High Contrast / Wikipedia.org / CC BY 3.0 DE
 Wie viel Kleidung besitzt du? (PNG - 2 MB)
Wie viel Kleidung besitzt du? (PNG - 2 MB)Foto: Wonderlane / Flickr.com / CC BY-NC 2.0
 Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie (PNG - 2 MB)
Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie (PNG - 2 MB)Foto: ILO Asia-Pacific / Flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0
 Produktion der Rohfasern (PNG - 2 MB)
Produktion der Rohfasern (PNG - 2 MB)Foto: Karl Wiggers / Unsplash.com / Unsplash-Lizenz
 Einsatz von Chemikalien (PNG - 2 MB)
Einsatz von Chemikalien (PNG - 2 MB)
 CO2-Ausstoß durch Transport (PNG - 2 MB)
CO2-Ausstoß durch Transport (PNG - 2 MB)Foto: Dominik Lückmann / Unsplash.com / Unsplash-Lizenz