Dein Handy, der Fernseher und die Wegwerfkultur (Basisvariante)
Überblick über den Unterrichtsverlauf
- Einstieg: Die Schüler*innen reflektieren im Plenum ihren Konsum von Elektrogeräten mithilfe einer Strichliste und setzen sich anhand einer Bilderserie mit den Umwelt- und sozialen Probleme auseinander, die mit der Herstellung und Entsorgung von Elektroartikeln zusammenhängen.
- Arbeitsphase: Die Schüler*innen bewerten in Partnerarbeit fiktive Werbeanzeigen für Elektroprodukte und gestalten anschließend eigene Werbeplakate.
- Abschluss: Die Schüler*innen stellen ihre Ergebnisse im Plenum vor. Sie bewerten die nachhaltigsten Ansätze und diskutieren den Sinn und Zweck ausgewählter Elektroprodukte.
Kompetenzen und Ziele
Die Schüler*innen …
- lernen grundlegende Auswirkungen des Konsums von Elektrogeräten kennen,
- erweitern ihre Methodenkompetenz im Rahmen der fragengeleiteten Gestaltung einer Werbeanzeige,
- schulen ihre Urteilskompetenz durch die Bewertung von Werbung,
- verbessern ihre Kommunikations- und Präsentationskompetenz durch das Arbeiten in Gruppen, die Teilnahme an Diskussionen und die Vorstellung von Ergebnissen,
- fördern ihre Handlungskompetenz durch die angeleitete Reflexion des eigenen Konsumverhaltens.
Umsetzung
Die Leitfragen der Unterrichtseinheit lauten:
- Wie können wir nachhaltig mit Elektroprodukten umgehen?
- Wie lässt sich Elektromüll vermeiden?
Einstieg
Zu Beginn der Unterrichtseinheit erhalten die Schüler*innen den Auftrag, ihren Konsum von Elektroartikeln zu reflektieren. Zunächst überlegen sie, welche elektrischen Geräte sie zu Hause haben. Gemeinsam sortieren sie die Geräte in vorgegebene Kategorien (Geräte des Haushalts, Geräte der Unterhaltungselektronik, Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, Lampen und Sonstiges) und tragen sie in einer entsprechenden Strichliste an der Tafel/dem Smartboard ein.
Gemeinsam besprechen die Schüler*innen das Ergebnis im Plenum. Zusätzlich regt die Lehrkraft im Plenum eine Diskussion zum Konsumverhalten mithilfe folgender Aufgabenstellungen an:
- Begründet, welche der genannten Artikel ihr wirklich wichtig findet.
- Nennt Gründe und Anlässe für den Kauf neuer Geräte.
- Beschreibt, was mit den Artikeln passiert, die nicht mehr genutzt werden.
- Überlegt, welche Voraussetzungen gegeben sein müssten, damit ihr defekte Geräte reparieren lasst. Begründet.
Anschließend präsentiert die Lehrkraft die Bilderserie "Produktion, Handel, Nutzung: Das Leben eines Handys".
Im Plenum besprechen die Schüler*innen die dargestellten Umwelt- und sozialen Probleme, die mit der Herstellung und Entsorgung von Elektroartikeln zusammenhängen. Ihre Erkenntnisse notieren sie gemeinsam in Form einer Mindmap an der Tafel/dem Smartboard. Diese dient als Kriterienliste für die weiteren Arbeitsphasen.
Die Lehrkraft fügt der Mindmap den Begriff "Wegwerfkultur" hinzu. Sie fordert die Schüler*innen auf, zu erläutern, was dieser bedeutet und welche der bisher genannten Aspekte/Probleme damit in Verbindung stehen.
Die Lehrkraft gibt hierbei Hilfestellung, zum Beispiel, indem sie auf folgende Aspekte aufmerksam macht:
- Der Konsum von Elektrogeräten ist in den vergangenen Jahren gestiegen.
- Elektrogeräte werden zum Teil nur für kurze Zeit genutzt (zum Beispiel Smartphones in Deutschland im Schnitt für zwei Jahre).
- Funktionsfähige oder nur leicht beschädigte Geräte werden entsorgt, statt weiter genutzt zu werden.
- Für die Herstellung der Produkte sind zahlreiche Rohstoffe nötig. Die Bodenschätze der Welt sind endlich.
- Die Herstellung, aber auch die Entsorgung benötigen Energie.
Arbeitsphase
Die Schüler*innen erhalten den Auftrag, Werbung zu vorgegebenen Elektroartikeln zu bewerten und anschließend eine eigene Werbeanzeige zu gestalten. Im Fokus der Werbung stehen Produkteigenschaften, die dazu beitragen, dass Elektroschrott vermieden wird. Die Schüler*innen erhalten dafür die Arbeitsblätter aus den Materialien.
Zunächst bewerten die Schüler*innen in Partnerarbeit die Produktanzeigen auf Arbeitsblatt 1. Die Anzeigen beschreiben verschiedene Produkteigenschaften, die dazu beitragen, dass mehr Elektroschrott entsteht beziehungsweise dass dieser vermieden wird. Die Schüler*innen besprechen, welche Produkteigenschaften nachhaltig sind und entwickeln Verbesserungsvorschläge für die nicht nachhaltigen Eigenschaften. Dabei berücksichtigen sie insbesondere, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit Produkte leicht repariert werden können.
In Gruppen tauschen sie sich über ihre Vorschläge aus. Ihre Ergebnisse halten sie in Form einer Checkliste für Produkte fest.
Anschließend wählt jede Arbeitsgruppe eines der vorgegebenen elektronischen Produkte. Die Schüler*innen überlegen sich Eigenschaften für das Produkt, die dazu beitragen, dass Elektroschrott vermieden wird. Zusätzlich entwickeln sie Aussagen/Slogans, mit denen sie das Produkt und dessen nachhaltige Eigenschaften bewerben möchten (zum Beispiel: "Lange Lebensdauer!", "Leicht zu reparieren!"). Sie verwenden ihre Ergebnisse, um ein Werbeplakat für ihr Produkt zu gestalten. Zur Unterstützung nutzen sie Arbeitsblatt 2.
Abschluss
Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse im Plenum vor. Die Schüler*innen der anderen Gruppen erhalten die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Dabei werden auch die Checklisten für Produkte verglichen und eine gemeinsame Liste mit allen wichtigen Kriterien festgehalten.
Anschließend wählen die Schüler*innen die effektivste Werbung beziehungsweise das nachhaltigste Produkt. Dafür nutzen sie die gemeinsam aufgestellte Checkliste.
Abschließend besprechen die Schüler*innen, was dazu beitragen kann, dass Konsument*innen nachhaltig mit Elektroprodukten umgehen. Dabei berücksichtigen sie insbesondere, welche Voraussetzungen gegeben sein müssten, damit die Produkte repariert oder länger verwendet werden können.
Erweiterung
- Die Schüler*innen besprechen mit Unterstützung der Lehrkraft, wie ein Elektrogerät richtig entsorgt wird beziehungsweise wie dessen Lebensdauer verlängert werden kann. Dazu besuchen sie entsprechende Sammelstellen in der Umgebung oder Plattformen für Secondhandware im Internet. Gegebenenfalls sammeln sie zuvor nicht benötigte Geräte, wie zum Beispiel Handys, im persönlichen Umfeld.
- Die Schüler*innen besuchen einen lokalen Wertstoffhof.
- Die Schüler*innen nehmen an einem Repaircafé oder einer ähnlichen Initiative teil. Je nach Möglichkeiten an der Schule beziehungsweise je nach Lerngruppe können die Schüler*innen ein Reparaturprojekt/Repaircafé an der Schule einrichten. Auch eine Schülerfirma ist denkbar.
![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer
Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
Dieses Werk ist lizenziert unter einer
Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
Sie dürfen diesen Text unter anderem ohne besondere Genehmigung verwenden und bearbeiten, z.B. kürzen oder umformulieren, sowie weiterverbreiten und vervielfältigen. Dabei müssen www.umwelt-im-unterricht.de als Quelle genannt sowie die oben genannte Creative Commons-Lizenz verwendet werden. Details zu den Bedingungen finden Sie auf der Creative Commons-Website.
![]() Umwelt im Unterricht unterstützt die Erstellung von Bildungsmaterialien unter offenen Lizenzen im Sinne der
UNESCO.
Umwelt im Unterricht unterstützt die Erstellung von Bildungsmaterialien unter offenen Lizenzen im Sinne der
UNESCO.

Foto: dokumol / Pixabay.com / Pixabay-Lizenz
Elektrogeräte bestehen aus vielen wertvollen Rohstoffen. Aber auch Schadstoffe stecken in den Produkten. Mit einer langen Lebensdauer und einer sachgerechten Entsorgung kann die Umwelt entlastet werden.
mehr lesen
Foto: Kilian Seiler / Unsplash.com / Unsplash-Lizenz
Die Arbeitsmaterialien helfen den Schüler*innen bei der Gestaltung einer Werbeanzeige zu einem vorgegebenem Elektronikartikel, welcher so gestaltet ist, dass Elektroschrott möglichst vermieden wird.
mehr lesen
Foto: andreahuyoff / Pixabay.com / Pixabay-Lizenz
In einem durchschnittlichen Mobiltelefon "stecken" schätzungsweise 60 Rohstoffe aus verschiedenen Ländern. Die Bildergalerie zeichnet den Lebenszyklus eines Handys nach. Vom Abbau der Rohstoffe über die Produktion zur Nutzung bis hin zur Entsorgung und Wiederverwendung einzelner Bestandteile.
mehr lesenMaterial herunterladen
- Elektrogeräte lange nutzen, reparieren und recyceln (Kurzfassung) - GS / SK (PDF - 54 KB)
- Elektrogeräte lange nutzen, reparieren und recyceln - GS / SK (PDF - 72 KB)
 Woher kommt dein Handy? (JPG - 764 KB)
Woher kommt dein Handy? (JPG - 764 KB)Foto: Luisella Planeta Leoni / pixabay.com / Pixabay Lizenz
 In Handys stecken viele Rohstoffe (JPG - 567 KB)
In Handys stecken viele Rohstoffe (JPG - 567 KB)Foto: Reinhard Jahn / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 2.0
 Gefährliche Förderung (JPG - 288 KB)
Gefährliche Förderung (JPG - 288 KB)Foto: Julien harneis / flickr.com /CC BY-SA 2.0
 Tantal: in kleinsten Mengen in jedem Mobiltelefon (JPG - 1 MB)
Tantal: in kleinsten Mengen in jedem Mobiltelefon (JPG - 1 MB)
 Das Handy besteht aus Einzelteilen (JPG - 189 KB)
Das Handy besteht aus Einzelteilen (JPG - 189 KB)Foto: Gdium / flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0
 Schuften am Fließband (JPG - 300 KB)
Schuften am Fließband (JPG - 300 KB)Foto: Steve Jurvetson / commons.wikimedia.org / CC BY 2.0
 Die Reise in den Laden (JPG - 220 KB)
Die Reise in den Laden (JPG - 220 KB)Foto: Sparklemotion / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 2.0
 Telefonieren überall (JPG - 204 KB)
Telefonieren überall (JPG - 204 KB)Foto: jamesmellor / flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0
 Nicht mehr gebraucht (JPG - 198 KB)
Nicht mehr gebraucht (JPG - 198 KB)Foto: magic_quote / flickr.com / CC BY 2.0
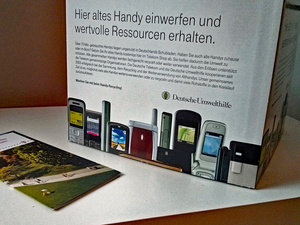 Her mit den alten Handys! (JPG - 299 KB)
Her mit den alten Handys! (JPG - 299 KB)Foto: sebastiankauer / flickr.com / CC BY-SA 2.0
 Goldmine Handy (JPG - 293 KB)
Goldmine Handy (JPG - 293 KB)Foto: Volker Thies / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 3.0
 Achtung, Giftmüll! (JPG - 256 KB)
Achtung, Giftmüll! (JPG - 256 KB)Foto: Lantus / commons.wikimedia.org / CC BY 2.0
Zielgruppe
Fächer
Schlagwörter
- Elektroschrott |
- Elektroaltgeräte |
- Handy |
- Recycling |
- Abfallvermeidung |
- Smartphone |
- Elektronik |
- Abfall |
- Wegwerfkultur |
- Reparatur


